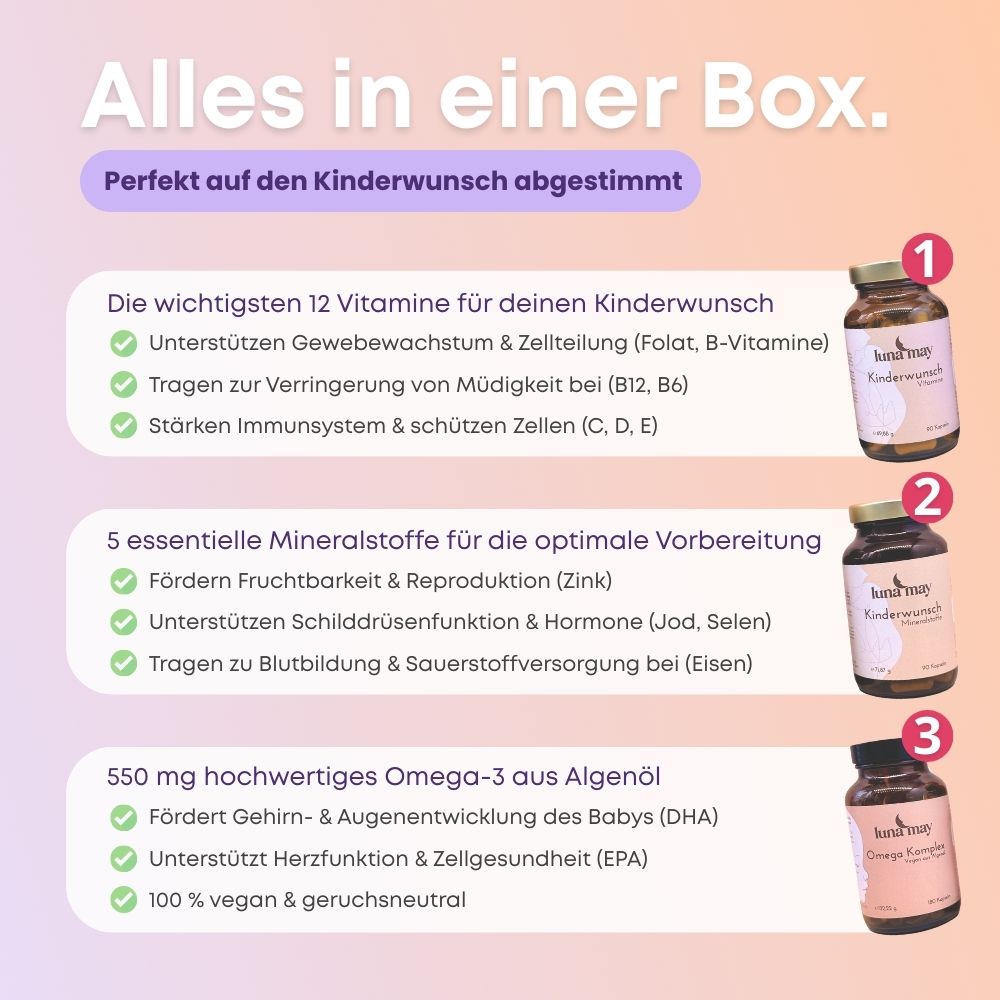Einleitung: Wenn Babys weinen – ist das wirklich immer „normal“
Inhaltsverzeichnis
Fast jede frischgebackene Familie kennt es: Das Baby schreit, und du weißt nicht warum. Du hast es gerade gestillt, gewickelt, getragen – und trotzdem scheint es untröstlich. Viele Eltern zweifeln dann an sich selbst, suchen nach Gründen oder gar nach Fehlern. Doch was, wenn das viele Weinen gar nicht biologisch „normal“, sondern eher ein kulturelles Phänomen ist?
Tatsächlich zeigen Studien: Babys in traditionellen Jäger- und Sammler-Gesellschaften weinen deutlich weniger als westliche Babys. Und das liegt nicht daran, dass sie „pflegeleichter“ wären – sondern daran, wie mit ihnen umgegangen wird.
Was Studien über das Weinverhalten von Babys zeigen
Bereits in den 1980er-Jahren beobachteten Forscher:innen wie Barr und Hunziker signifikante Unterschiede im Weinverhalten von Babys – je nachdem, wie viel Körperkontakt sie erhielten und wie prompt auf ihre Bedürfnisse reagiert wurde. In Studien zeigte sich, dass Babys, die häufig getragen wurden und auf deren Weinen unmittelbar reagiert wurde, deutlich weniger schrien als solche, deren Signale weniger direkt beantwortet wurden.
In den 1970er-Jahren dokumentierte der US-amerikanische Anthropologe Dr. Melvin Konner, dass !Kung-Babys (Namibia/Botswana) im Vergleich zu westlichen Säuglingen viermal so häufig gestillt werden – oft im Minutentakt. Im Gegenzug schrien sie nur einen Bruchteil der Zeit.
Auch moderne Studien bestätigen das:
Eine groß angelegte Analyse von Walker et al. (JAMA Pediatrics, 2017) verglich Schreimuster in acht Ländern:
→ Babys in Großbritannien, Kanada und Italien weinten am meisten,
→ während Babys in Dänemark, Japan und Kamerun deutlich weniger weinten – besonders in den ersten 12 Wochen.Eine Studie aus Kamerun (Morelli et al., 1992) zeigte, dass Babys dort durchschnittlich 16 bis 18 Stunden pro Tag getragen werden, während sie in der westlichen Welt oft mehrere Stunden am Tag allein in Wippen oder Kinderwagen verbringen.
Auch bei den Efe (Demokratische Republik Kongo) wird das Baby permanent körpernah getragen und bekommt 20–40 Stillmahlzeiten täglich – Weinen ist selten.
Warum Babys in traditionellen Kulturen weniger weinen
In vielen indigenen Gesellschaften gehören Babys zum Alltag der Erwachsenen. Sie sind eingebunden, werden getragen, in Gespräche integriert und bei Bedarf gestillt – oft ohne sichtbaren Rhythmus, sondern ganz nach Situation und Bedürfnis.
1. Nähe, Körperkontakt & ständige Begleitung
Babys sind Traglinge – ihr ganzes Nervensystem ist auf Nähe programmiert. In traditionellen Kulturen wie bei den !Kung, Efe oder Baka werden Babys:
fast rund um die Uhr getragen oder gehalten (auch beim Kochen, Gehen, Schlafen),
beim ersten Mucks sofort beruhigt (meist durch Anlegen oder Schaukeln),
nie alleine abgelegt – der soziale Körperkontakt ist Dauerzustand.
→ Das Baby muss gar nicht laut weinen, um gehört zu werden – leise Signale reichen.
2. Stillen nach Bedürfnis – nicht nach Plan
In vielen traditionellen Kulturen wird nicht nach Uhrzeit gestillt, sondern nach Signal. Das kann alle 10 Minuten oder alle 2 Stunden sein – je nach Bedürfnis.
Ein Baby, das auf diese Weise versorgt wird:
bleibt satt und reguliert,
hat keinen Stress durch Hunger oder Durst,
erfährt, dass es gehört wird – das stärkt Vertrauen und Nervensystem.
Bei den !Kung wurden 50–70 Stillmahlzeiten pro Tag dokumentiert – kurz, spontan und direkt auf das Signal des Babys reagierend.
3. Allomütterliche Unterstützung
In vielen traditionellen Gemeinschaften wird ein Baby nicht nur von der Mutter betreut. Tanten, ältere Geschwister, Cousinen oder Großmütter übernehmen aktiv Verantwortung:
tragen,
wiegen,
beruhigen,
spielen,
in manchen Kulturen sogar stillen (Cross-Nursing).
Dieses Netzwerk entlastet die Mutter – und ermöglicht dem Baby kontinuierliche Fürsorge.
4. Reizarme, natürliche Umgebung
Unsere westliche Welt ist voll von:
künstlichem Licht,
Lärm,
wechselnden Reizen,
planvollem Alltag.
Ein Baby reagiert darauf oft mit Überstimulation – was sich durch Schreien äußern kann. In traditionellen Kulturen ist der Tagesrhythmus natürlicher, die Reize sind sanft und wiederkehrend – das Baby ist weniger gestresst.
Traditionelle Lebensweisen ermöglichen es also, dass Eltern unmittelbarer und oft intuitiver auf ihre Kinder reagieren. Dies reduziert nicht nur das Weinen, sondern stärkt auch die frühkindliche Bindung und das emotionale Grundvertrauen.

Diese Punkte zeigen: Auch in einem westlichen Kontext können wir Elemente eines bindungsorientierten Umgangs mit Babys integrieren – angepasst an unsere Lebensrealität und Möglichkeiten.
Was bedeutet das für uns heute?
Natürlich ist es nicht ohne Weiteres möglich, den Alltag eines Nomadenvolkes in unser modernes Leben zu übertragen. Doch bestimmte Prinzipien sind übertragbar – und wirken sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden von Eltern und Kindern aus.
Einige alltagstaugliche Impulse, die wir aus traditionellen Kulturen ableiten können:
Tragen statt Liegenlassen: Tragetücher oder ergonomische Babytragen ermöglichen Nähe, fördern Bindung und beruhigen. Körperkontakt wirkt regulierend auf Atmung, Herzschlag und das Nervensystem des Babys.
Du musst das nicht allein schaffen: Suche dir – wenn möglich – Unterstützung: Partner:in, Großeltern, Doula, Wochenbetthebamme, Stillgruppe.
Nähe ist keine Verwöhnung, sondern ein biologisches Bedürfnis: Ein Baby, das viel getragen wird, schreit oft weniger – weil es sich sicher fühlt.
Stillen nach Bedarf: Es ist völlig normal, dass Babys keine festen Essenszeiten haben. Häufiges Stillen – auch für nur wenige Minuten – ist evolutionär normal und sinnvoll.
Nähe auch nachts: Co-Sleeping (gemeinsames Schlafen) oder ein Beistellbett kann die Schlafqualität und emotionale Sicherheit steigern.
Feinfühligkeit statt Regeln: Eltern dürfen ihren eigenen Rhythmus finden. Das Weinen eines Babys ist kein Erziehungsproblem, sondern ein Signal – und das Beantworten dieses Signals stärkt die Beziehung.
Dein Baby ist nicht „anstrengend“ – es sendet Signale: Wenn du den Rahmen veränderst, verändert sich oft auch das Verhalten deines Babys.
Häufige Missverständnisse & Mythen
Viele der heute noch kursierenden Erziehungstipps rund ums Babyweinen stammen aus einer Zeit, in der man dachte, man müsse Babys „nicht verwöhnen“. Moderne Bindungsforschung sieht das anders.
Mythos 1: Babys manipulieren mit Weinen.
→ Falsch. Babys haben keine strategischen Absichten. Sie kommunizieren über Weinen – immer.
Mythos 2: Ein Baby muss lernen, sich selbst zu beruhigen.
→ Falsch. Selbstregulation ist erst später möglich. Neugeborene brauchen Co-Regulation: Nähe, Trost, Körperkontakt.
Mythos 3: Stillen in kurzen Abständen ist ungesund oder verwöhnt.
→ Falsch. In vielen traditionellen Gesellschaften wird bis zu 20-mal am Tag gestillt – oft nur wenige Minuten lang. Es ist normal, dass Babys in kleinen Portionen trinken, besonders in den ersten Lebensmonaten.
Mythos 4: Tragen verzögert die motorische Entwicklung.
→ Falsch. Babys, die viel getragen werden, erhalten durch das Tragen viele vestibuläre Reize – das fördert Gleichgewichtssinn, Koordination und Muskeltonus.
Mythos 5: Wenn du immer sofort reagierst, lernt es nie, allein zu schlafen.
→ Falsch. Sicherheit ist der Boden, auf dem sich Selbstregulation entwickelt – nicht Isolation.
Diese Missverständnisse führen oft zu Verunsicherung. Wichtig ist es, sich an wissenschaftlich fundierten Informationen und der eigenen Intuition zu orientieren – und nicht an überholten Ratschlägen.

Hat die Art, wie wir geboren werden, einen Einfluss auf das Weinverhalten?
Ja, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Geburtserfahrung – sowohl für Mutter als auch Baby – einen Einfluss darauf hat, wie oft und wie intensiv ein Baby in den ersten Lebenswochen weint.
Babys, die durch eine vaginale, interventionsarme Geburt zur Welt kommen, erleben meist einen intensiven Hormon-Cocktail, der ihnen den Übergang in die Welt erleichtert. Hormone wie Oxytocin, Adrenalin und Endorphine helfen dabei, den Stress der Geburt zu regulieren und fördern direkt nach der Geburt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Diese enge körperliche und hormonelle Verbindung kann das Bedürfnis zu weinen verringern, da sich das Baby sicherer und regulierter fühlt.
Studien zeigen außerdem:
Kaiserschnitt-Geburten (insbesondere geplante, ohne vorherige Wehen) können mit einem verzögerten Aufbau der Mikroflora, einer weniger reaktiven Stressantwort und einer geringeren Stillquote in Verbindung stehen.
Trennung nach der Geburt (z. B. bei medizinischen Eingriffen) kann die Fähigkeit des Babys zur Selbstregulation beeinträchtigen, was sich in häufigem Weinen äußern kann.
In traditionellen Kulturen findet die Geburt meist in vertrauter Umgebung statt, mit vertrauten Personen und ohne Trennung direkt danach. Hautkontakt, Stillbeginn innerhalb der ersten Stunde und unmittelbare Integration ins Familienleben sind dort selbstverständlich – und das scheint sich langfristig beruhigend auszuwirken. Auch dies könnte ein Teil der Antwort darauf sein, warum Babys dort deutlich seltener schreien.
Traditionelle Kulturen & natürliche Rhythmen vs. westliche Reizüberflutung
Ein oft übersehener Aspekt beim Weinen von Babys ist das gesamte Umfeld, in dem sie aufwachsen – und wie es ihren Rhythmus beeinflusst. Der Unterschied zwischen dem Leben in traditionellen, naturnahen Kulturen und dem in modernen westlichen Gesellschaften ist dabei enorm – und wird zunehmend wissenschaftlich beleuchtet.
In vielen Jäger- und Sammlergesellschaften wie bei den !Kung in Afrika, den Hadza in Tansania oder den Efe im Kongo gibt es keine starren Tagesstrukturen. Babys sind ständig bei der Mutter oder einer anderen Bezugsperson, schlafen in Tüchern, werden auf dem Rücken getragen, trinken, wann sie möchten – und zwar oft nur für wenige Minuten, aber sehr häufig. Es gibt keine starren Fütterungsintervalle, keine festgelegten Schlafenszeiten, keine isolierten Kinderzimmer.
→ Das Leben folgt dem Rhythmus des Babys – nicht umgekehrt.
In modernen westlichen Gesellschaften hingegen erwartet man von Babys oft, dass sie sich in feste Tagesabläufe und Routinen einfügen, manchmal schon in den ersten Wochen. Babys sollen "lernen" zu schlafen, feste Stillabstände haben, sich allein beschäftigen können, möglichst bald in Krippen eingewöhnt werden – all das steht in starkem Kontrast zur biologischen Erwartung des Babys an Sicherheit, Nähe und Reaktion.
Reizüberflutung ist ein weiterer Faktor:
In Städten sind Babys oft lauten Geräuschen, grellem Licht, vielen Fremdpersonen, Verkehr und vollen Terminkalendern ausgesetzt. Schon in den ersten Monaten gibt es Babykurse, PEKiP, Schwimmen, Musikgruppen – alles gut gemeint, aber nicht immer dem kindlichen Bedürfnis entsprechend. Studien zeigen, dass eine zu hohe Reizdichte zu Unruhe, Schlafproblemen und vermehrtem Weinen führen kann (Barr et al., 2005).
Im Gegensatz dazu wachsen Babys in naturnahen Kulturen in sensorisch harmonischeren Umgebungen auf:
sanfte Hintergrundgeräusche (Stimmen, Natur, Tiere),
direkte Körpernähe,
flexible Schlaf- und Stillzeiten,
kaum Trennung von Bezugspersonen,
wenig künstliche Stimulation, aber viel echte Interaktion.
Forscher wie Dr. James McKenna oder Jean Liedloff haben wiederholt betont, wie tief unsere evolutionären Bedürfnisse in uns verwurzelt sind – und dass viele der heutigen Herausforderungen (wie "Schreibabys", Schlafprobleme oder Regulationsstörungen) Ausdruck davon sein können, dass die äußere Welt nicht mehr zum inneren Bauplan des Babys passt.

EXKURS: Ist plötzlicher Kindstod (SIDS) ein Thema in traditionellen Kulturen?
Der plötzliche Kindstod (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome) ist eines der erschütterndsten Themen für junge Eltern. In westlichen Ländern wurde über Jahrzehnte intensiv geforscht, und viele Empfehlungen wie Rückenschlaf, rauchfreie Umgebung, Raumtemperaturkontrolle oder Stillen haben die SIDS-Raten deutlich gesenkt.
Interessanterweise wird aus traditionellen Kulturen nur sehr selten über SIDS-Fälle berichtet – obwohl dort häufig Bedingungen vorherrschen, die in westlichen Kontexten als „riskant“ gelten würden, z. B. Co-Sleeping oder das Schlafen auf Tierfellen.
Woran liegt das?
Einige Erklärungsansätze aus der Forschung:
Ständiger Körperkontakt: Babys schlafen meist auf oder direkt an der Mutter, was durch ihre Atembewegungen und Körperwärme regulierend wirkt.
Stillen rund um die Uhr, oft im Halbschlaf, hat einen schützenden Effekt auf die Atemregulation.
Babys schlafen selten allein oder in starren Schlafrhythmen. Die Umgebung ist oft laut, dynamisch und voller Körpernähe – was den Übergang zwischen Schlafphasen erleichtert und das Risiko für Atemaussetzer verringern kann.
Zudem zeigen Studien, dass das alleinige Schlafen in separaten Betten oder Zimmern in den ersten Lebensmonaten mit einem höheren SIDS-Risiko assoziiert sein kann – genau das ist in traditionellen Gesellschaften praktisch unbekannt.
All dies deutet darauf hin: Es ist nicht die Nähe an sich, die ein Risiko birgt, sondern wie diese gestaltet wird – sicher, feinfühlig, rauchfrei und wachsam. Auch hier lohnt sich der Blick in andere Kulturen, um über vermeintlich „sichere“ Schlafgewohnheiten neu nachzudenken.
Fazit: Weinen ist Kommunikation – aber nicht unausweichlich
Babys in traditionellen Gesellschaften wie bei den !Kung oder Efe zeigen, dass Weniger-Weinen kein Mythos, sondern biologisch möglich ist. Der Unterschied liegt nicht im Baby, sondern in der Art, wie wir begleiten.
Ein Baby, das gehört, gehalten und verstanden wird, muss sich nicht in den Schlaf schreien. Es darf ankommen – in einer Welt, in der es sich sicher fühlt.